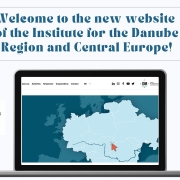Endlich frei von Ideologie werden!

Polen machte 2019 mit der Ausrufung sogenannter »LGBT-freier Zonen« internationale Schlagzeilen. MALWINA TALIK berichtet von lokalen Aktionen und Strategien gegen die homophobe Politik.
Polen wurde 2019 zum Schauplatz einer beunruhigenden Entwicklung: Viele Gemeinden, Landkreise und Woiwodschaften (polnisches Pendant der Bundesländer) erklärten sich binnen kurzer Zeit zu »LGBT-(ideologie)freien Zonen« oder schlossen ähnliche homophobe Resolutionen ab. Es ist die Folge eines langandauernden Kulturkampfes, der in Polen seit die PiS-Partei 2015 an die Macht kam, zugenommen hat. Der unmittelbare Auslöser war jedoch eine scheinbar unauffällige und an sich positive Entscheidung des progressiven Warschauer Bürgermeisters Rafał Trzaskowski. Dieser unterzeichnete eine »Erklärung zur Unterstützung von LGBT-Rechten«. Auf Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation sollten queere Themen in den Sexualunterricht (in Polen heißt dieser »Erziehung zum Familienleben«) an Warschauer Schulen aufgenommen werden. Zwar lehnten die nationalkonservativen RegierungspolitikerInnen diesen Schritt mit dem Argument der vermeintlichen »Sexualisierung von Kindern« ab, es waren aber die Behörden auf lokaler Ebene im konservativen Süden und Osten des Landes, die konkrete Maßnahmen dagegen ergriffen. Im März 2019 deklarierten sich erste Ortschaften als »LGBT-frei«. Bald befand sich rund ein Drittel Polens in den selbsternannten Zonen. Die nationalkonservative Zeitung »Gazeta Polska« gab sogar einen »LGBT-freie Zone«- Aufkleber gratis zu einer ihrer Ausgaben hinzu. Die Resolutionen hatten zwar keine rechtliche Wirkung, sie sendeten allerdings ein klares Signal: Wer nicht nach dem traditionellen Familienbild lebt oder diesen Werten folgt, hat hier nichts verloren. Für queere Menschen wurde damit eine weitere rote Linie überschritten. Seit Jahren wandern Betroffene aus Polen aus. Wer bleibt, findet unterschiedliche Wege, um der Homophobie die Stirn zu bieten.
Vorwurf der Ideologie
Um die homophoben »Zonen« sichtbar zu machen, erstellte eine Gruppe von AktivistInnen aus dem ostpolnischen Rzeszów die digitale Landkarte »Atlas des Hasses«. Sie zeigt wo entsprechende Resolutionen verabschiedet, abgelehnt oder in Betracht gezogen wurden. Die InitiatorInnen informieren ebenso darüber, welche Maßnahmen die BürgerInnen ergreifen können, falls ihre Gemeinde so eine Resolution plant. Auch der aus dem ostpolnischen Lublin stammende Aktivist Bart Staszewski machte auf das Ausmaß der »Zonen« mit einer Aktion aufmerksam. Er reiste zu den betroffenen Orten und hing selbstgemachte Schilder mit der Inschrift »LGBT-freie Zone« auf Polnisch, Englisch, Französisch und Russisch an die jeweiligen Ortstafeln. Dann machte er Fotos von Betroffenen vor dem Schild. Seine Protestaktion erhielt bald internationale Aufmerksamkeit. Das Time Magazine setzte Staszewski auf die Liste der »Emerging Leaders« und die Obama Foundation lud ihn zu ihrem Europe-LeadersProgramm ein. Dadurch machte Staszewski verstärkt auf die Homophobie in Polen aufmerksam. Die Gemeinden rechneten nicht mit dem großen Interesse und der internationalen Empörung. Manche zogen die Beschlüsse zurück, andere zeigten AktivistInnen wie Staszewski oder die AutorInnen des Atlas wegen vermeintlicher Verleumdung an. Abgeordnete beteuerten immer öfter, dass sie eigentlich nichts gegen queere Menschen hätten, sondern gegen die sogenannte »LGBT-Ideologie«. Was genau hinter diesem Begriff stecken soll, ist aber unklar. Rechtliche Unterstützung kommt von Ordo Iuris, einer ultrakonservativen Vereinigung. Sie stellte auch eine Muster-Resolution, die sogenannte »Familien-Charta« zur Verfügung, die die Ehe zwischen Mann und Frau durch queeren Sexualunterricht
an Schulen als gefährdet propagiert.
Glaube unter dem Regenbogen
Die katholische Kirche in Polen positioniert sich eindeutig gegen LGBTQIA+ und verbreitet diese Haltung während Predigten und über eigene Medien. Sie setzt sich auch für sogenannte »Konversionstherapien« ein, die Homosexualität als heilbare Krankheit verstehen. Solchen Praktiken fehlt jedoch jede wissenschaftliche Basis, die Bezeichnung Therapie ist somit irreführend. Das offenbart ihren rein ideologischen Charakter. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Kirche Einfluss auf die nationalkonservative PiS-Regierung ausübt und dadurch auf das regierungstreue öffentliche Fernsehen. Marek Jędraszewski, Erzbischof von Krakau und stellvertretender Vorsitzender der Polnischen Bischofskonferenz, bezeichnete die LGBTQIA+ Community als »neue Seuche in den Farben des Regenbogens«. Unter den Kirchenvertretern ist er mit Aussagen wie dieser nicht allein. Die Ausgrenzung betrifft insbesondere queere Gläubige. Für sie bietet seit einigen Jahren die außerkirchliche Gruppe »Glaube und Regenbogen« in sechs polnischen Großstädten Unterstützungsleistungen an. Neben lokalen Treffen berät die Gruppe auch Betroffene und Angehörige und organisiert Kampagnen, an denen sich auch liberale christliche Medien beteiligen.
Kunst für Nächstenliebe
Da die katholische Kirche als Motor der Homophobie in Polen betrachtet wird, stehen religiöse Symbole oft im Zentrum des Protests. So verpassten drei AktivistInnen der stark verehrten Madonna von Częstochowa durch digitale Bildbearbeitung einen Heiligenschein in den Farben des Regenbogens (Cover). Die Plakate klebten sie in der Nähe von Kirchen auf. Die Botschaft: Maria würde ihren Sohn, auch wenn er queer wäre, akzeptieren. Die AktivistInnen wurden 2019 wegen Beleidigung religiöser Gefühle angeklagt, eine von ihnen temporär verhaftet und vor kurzem freigesprochen. Die »Regenbogen-Madonna« wurde so auch international bekannt. Eine andere Aktion kam von dem schwulen Künstler Daniel Rycharski. Seine Werke handeln von Homosexualität und Glaube. Er kehrte nach Jahren in Krakau wieder in sein Heimatdorf Kurow zurück, um dort mithilfe von Kunst auf die Ausgrenzung der LGBTQIA+ Community aufmerksam zu machen. Unter anderem stellte er Kreuze auf, auf denen Kleidung queerer Menschen hing. Wie Vogelscheuchen würde ihre sexuelle Orientierung und Geschlechts-identität die Leute abschrecken. Seine Ausstellung »Alle unsere Ängste«, die im Museum für Moderne Kunst in Warschau präsentiert wurde, thematisiert die Frage, wie man ChristIn bleiben kann, wenn die eigene Kirche einen ablehnt. Die öffentlichkeitswirksame Ausstellung führte dazu, dass der Kulturminister eine Rechtfertigung von der Direktorin des Museums verlangte.
Druckmittel im Lokalen
LokalpolitikerInnen sind den BürgerInnen oft näher als RegierungspolitikerInnen und können auch leichter konfrontiert werden. Durch die homophoben Resolutionen fühlten sich viele Betroffene in den Gemeinden ausgegrenzt. Piotr aus Südpolen (Name geändert) erklärt, dass sich daraufhin einige outeten und die LokalpolitikerInnen mit der Frage konfrontierten, warum sie stigmatisiert werden. Dieser persönliche Kontakt bewirkte in vielen Fällen eine Änderung. Schließlich zogen viele Gemeinden die homophoben Beschlüsse zurück. In mehreren Fällen wurden die Resolutionen durch Gerichtsurteile aufgehoben, dasselbe Schicksal teilten die »LGBT-freie Zone«-Aufkleber, die verboten wurden. Sowohl direkte lokale Initiativen als auch internationales Aufsehen führten dies herbei. Die Kritik der EU-Kommission und die Aussetzung der Zusammenarbeit durch westeuropäische Partnerstädte zwangen Gemeinden, ihre Beschlüsse neu zu überdenken. Sie mussten auch mit der Streichung von Fördergeldern rechnen. Für viele regionale Abgeordnete war der Druck zu groß. »Die Politik versucht die Welt schwarz und weiß darzustellen, sie hat aber alle Farben des Regenbogens«, sagt Piotr. Wie viele andere queere Menschen wartet er darauf, dass sich Polen von der einzig schädlichen Ideologie befreit: jener des Nationalismus, der Diskriminierung und des Hasses.
LGBTQIA+ steht für Lesbisch, Schwul (gay), Bisexuell, Trans, Queer, Intersex, Asexuell. Der Begriff beschreibt sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten. Das + soll weitere Orientierungen und Identitäten entlang des Spektrums inkludieren.
Autorin: Malwina Talik
»Die Schlacht ist noch lange nicht gewonnen«

Gemeinsam mit seinen Kollegen aus Warschau, Prag und Budapest gründete Bratislavas Bürgermeister Matúš Vallo 2019 den Pakt der Freien Städte – mit dem Ziel, sich anti-demokratischen Tendenzen in der Region entgegenzustellen. Der Ukraine-Krieg zeige, wie falsch Viktor Orbáns illiberale Politik sei, so Vallo im IDM-Interview. DANIELA APAYDIN hat mit ihm über die Veränderungskraft von Städten und ihren Allianzen gesprochen.
Mit einiger Verspätung schaltet sich Matúš Vallo zu unserem Zoom-Call hinzu. Er wirkt geschäftig, entschuldigt sich für die Wartezeit. Interviewanfragen von österreichischen Medien seien eher selten, an internationaler Aufmerksamkeit mangele es aber nicht, heißt es aus dem Pressebüro. Vallo spricht fließend Englisch. Er hat in Rom Architektur studiert, in London gearbeitet und erhielt ein Fulbright-Stipendium an der Columbia University in New York. Als politischer Quereinsteiger wurde er 2018 zum Bürgermeister von Bratislava gewählt. Im Herbst kämpft der 44-Jährige um die Wiederwahl zum Bürgermeister.
Herr Vallo, der US-amerikanische Politikberater Benjamin Barber argumentiert in seinem Buch »If Mayors Ruled the World« (2013), dass BürgermeisterInnen wirksamer auf transnationale Probleme reagieren als nationale Regierungen. Manche sprechen in diesem Zusammenhang von einer »lokalen Wende« des Regierens und Verwaltens. Leisten Städte und BürgermeisterInnen wirklich bessere Arbeit?
Ich kenne das Buch, und ich glaube an dieses Narrativ. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, wie Regierungen den Kontakt zu ihrer Basis verloren haben. Als Bürgermeister kann ich diesen Kontakt nicht verlieren, selbst wenn ich das wollte. Alle guten BürgermeisterInnen, die ich kenne, gehen gern durch ihre Stadt und treffen Menschen. Manchmal halten sie dich an und erzählen dir von einem Problem. Als BürgermeisterIn bist du ein Teil der Gemeinschaft. Du kannst nicht nur leere Versprechungen geben. Du musst Ergebnisse vorweisen können. Städte sind auch flexibler und ergebnisorientierter als nationale Regierungen. BürgermeisterInnen sorgen für die Qualität des öffentlichen Raums. So ist zum Beispiel die Anzahl der Spielplätze in einem Bezirk sehr wichtig. Das klingt simpel, aber der öffentliche Raum ist ein Schlüsselelement dafür, wie die Menschen ihr Leben gestalten.
Sie sind einer von vier Bürgermeistern, die den Pakt der Freien Städte (englisch: Pact of free Cities) unterzeichneten. Damit positionierten Sie sich gemeinsam mit Budapest, Prag und Warschau als pro-europäisches und anti-autoritäres Städtebündnis. Mit welchen Absichten sind Sie dieser Allianz damals beigetreten und wie würden Sie deren Erfolge heute bewerten?
Der Pakt wurde als ein Bündnis der VisegradHauptstädte geschlossen, um ein Gegengewicht zu den antidemokratischen und illiberalen Kräften zu bilden. Wir sind durch unsere Werte verbunden. Wir wollen den Populismus bekämpfen, Transparenz fördern und bei gemeinsamen Themen wie der Klimakrise zusammenarbeiten. Natürlich gab es schon vorher Bündnisse zu verschiedenen Themen, aber dies ist vielleicht das erste Mal, dass diese Werte im Mittelpunkt stehen.
Der Pakt der Freien Städte wurde am 16. Dezember 2019 an der Central European University in Budapest unterzeichnet. Wenig später mussten die meisten Abteilungen der Universität aufgrund politischer Repressionen nach Österreich umziehen. Erst kürzlich wurde Viktor Orbáns nationalkonservative Fidesz-Partei wiedergewählt. Ist der von Orbán propagierte Illiberalismus wieder auf dem Vormarsch? Wie reagieren die BürgermeisterInnen des Paktes darauf und wie unterstützen Sie sich gegenseitig?
Der Illiberalismus ist auf dem Vormarsch, einige führende PolitikerInnen konnten zurückschlagen, aber die Schlacht ist noch lange nicht gewonnen. Der jüngste Sieg von Viktor Orbán ist ein Beweis dafür. Wir sehen, dass die illiberale Demokratie bestimmten Gruppen oder einzelnen BürgerInnen Vorteile verschafft. Wir sehen aber auch, dass die Situation in der Tschechischen Republik anders ist und dass in Polen bald Wahlen stattfinden werden. Warschaus Bürgermeister, Rafał Trzaskowski, ist eine große Hoffnung für uns alle. Auch in der Slowakei haben wir eine pro-europäische Regierung und ich freue mich darüber, wie sie die Dinge regelt, um der Ukraine zu helfen. Von dort, wo ich jetzt sitze, sind es nur sechs Autostunden bis zur ukrainischen Grenze. Dieser Krieg zeigt auch, dass Orbán im Unrecht ist. Seine Unterstützung für Russland bedeutet auch die Unterstützung eines Regimes, das unschuldige Menschen tötet. Wo sehen Sie die konkreten Vorteile in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen BürgermeisterInnen und Städten? Da gibt es zwei Ebenen: Erstens geht es darum, miteinander zu reden. Bratislava ist die kleinste Stadt unter den Gründungsmitgliedern. Daher waren wir sehr froh, als wir in den ersten Wochen des Ukraine-Krieges die Bürgermeister von Warschau und Prag um Know-how und Ratschläge bitten konnten. Ich bin nach Warschau geflogen und habe mich mit dem Bürgermeister darüber beraten, wie sich die Stadt darauf vorbereitet. Der Pakt bietet eine sehr konkrete und direkte Möglichkeit, Wissen auszutauschen. Die zweite Ebene ist die Bildung eines Bündnisses von BürgermeisterInnen mit den gleichen Werten, die auch bereit sind, auf europäischer Ebene für diese Werte zu kämpfen. Durch die Pandemieerfahrung ist die Position der Städte noch stärker als zuvor. Ich glaube, dass in vielen Ländern die Städte und ihre BürgermeisterInnen die Situation gut meisterten. Die Menschen nehmen die Städte als ihre Partner wahr. Deshalb ist es wichtig, die Kräfte zu bündeln und mit einer klaren Stimme zu sprechen.

© patri via Unsplash
In Medienberichten wurden die Gründungsmitglieder des Pakts auch als »liberale Inseln in einem illiberalen Ozean« dargestellt. Diese Metapher birgt jedoch die Gefahr, bereits bestehende Gräben zwischen der urbanen, oft liberaler eingestellten, Bevölkerung und konservativeren BürgerInnen in ländlichen Gebieten zu vertiefen.
Ich verwende diese Metapher nie, und ich versuche auch nicht, diese Spaltung vorzunehmen. Ich bin mir über meine Werte im Klaren, aber als Bürgermeister setze ich mich für Dinge ein, die allen zugutekommen, etwa Spielplätze oder bessere öffentliche Verkehrsmittel. Das ist keine Frage von konservativen oder liberalen Werten. Wir haben Prides in Bratislava, aber wir unterstützen auch die OrganisatorInnen eines großen Treffens der christlichen Jugend. Ich arbeite mit konservativen und liberalen KollegInnen zusammen. Ich weiß, dass das schwierig sein kann, aber wir versuchen, die Menschen zu verbinden. Einige PolitikerInnen nutzen die Spaltung aus, weil sie wollen, dass sich die Menschen streiten, aber ich möchte lieber für eine gute Lebensqualität arbeiten.
Wenn Sie sich von der nationalen Regierung etwas wünschen könnten, das die Städte stärken würde, was wäre das?
Unser Verhältnis zur slowakischen Regierung ist nicht ideal. Auch nach COVID sieht man uns nicht als Partner. Wir brauchen klare Regeln und mehr Finanzmittel, denn im Vergleich zu anderen europäischen Städten sind wir sehr unterfinanziert.
Interview mit Daniela Apaydin und Matúš Vallo. Matúš Vallo ist ein slowakischer Politiker, Architekt, Stadtaktivist, Musiker und Bürgermeister von Bratislava. 2018 wurde er als unabhängiger Kandidat mit 36,5 Prozent der Stimmen an die Spitze der slowakischen Hauptstadt gewählt. 2021 zeichnete ihn der internationale Thinktank City Mayors mit dem World Mayor Future Award aus.
Zuerst Widerstand, dann Wahlkampf

Grünparteien hatten es in Serbien bisher schwer. Doch im ganzen Land finden sich zunehmend Protestbewegungen gegen Naturzerstörung. 13 Abgeordnete der linksgrünen Liste MORAMO bringen nun den Protest von der Straße ins Parlament. Mit einer von ihnen, BILJANA ĐORĐEVIĆ, sprach MELANIE JAINDL über Serbiens Chancen auf Veränderung.
An einem grauen Jännertag läuft ein Mann mit erhobenen Händen auf die Belgrader Stadtautobahn. In der letzten Sekunde weichen heranrasende Fahrzeuge aus. Sie werden die letzten sein, die in der kommenden Stunde vorankommen – die lauten Trillerpfeifen verraten, es folgen ihm noch Tausende. Auf ihren Schildern steht: »Serbien steht nicht zum Verkauf« und »Wir geben Jadar nicht auf« (Ne damo Jadar). Letzteres bezieht sich auf das westserbische Jadar-Tal, in dem der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto Lithium abbauen will. Nach wochenlangen Protesten zum Jahreswechsel entzog die serbische Regierung Rio Tinto die Lizenz. Schon davor entlud sich die Unzufriedenheit mit Serbiens politischer Entwicklung auf der Straße. Der skandierte Spruch »Ne damo« (Wir geben nicht auf) ist dabei immer wieder zu hören. Bereits 2014 organisierten sich DemonstrantInnen in Belgrad unter der Initiative Ne Da(vi)mo Beograd (NdB), die in den darauffolgenden Jahren zahlreiche AnhängerInnen fand. Unter dem Wortspiel »Wir lassen Belgrad nicht ertrinken/Wir geben Belgrad nicht auf« setzte sich NdB gegen die Gentrifizierung des Stadtteils Savamala und die Privatisierung des Flussufers ein – ohne Erfolg. Mittlerweile stehen die ersten Wolkenkratzer der abu-dhabischen Firma Eagle Hills am Ufer der Save. Hier entsteht ein luxuriöser neuer Bezirk, die Belgrade Waterfront. Beide Protestbewegungen – sowohl gegen Rio Tinto als auch gegen Waterfront – haben ähnliche Forderungen. Sie sind gegen ausländische Finanzspekulationen, gegen Enteignung der lokalen Bevölkerung und für Umweltschutz. Mit Biljana Đorđević haben die Demonstrierenden nun eine Stimme im serbischen Parlament.
Akademikerin, Aktivistin und bald Abgeordnete
Biljana Đorđević ist Dozentin an der Politikwissenschaftlichen Fakultät der Universität Belgrad und wurde 2022 in die parlamentarische Versammlung Serbiens gewählt. Sie war Spitzenkandidatin auf der nationalen Liste der grün-linken Oppositionskoalition MORAMO (Wir müssen), zu der neben zwei weiteren Organisationen auch NdB gehört. »Anfänglich war ich nur Sympathisantin der Initiative und ging auf Proteste«, sagt Đorđević im Interview mit Info Europa. Immer öfter besuchte sie Vernetzungstreffen der Gruppe, bis sie jeden Tag dort war. Schließlich wurde sie zur politischen Koordinatorin von NdB. »2018 kam der Entschluss, bei den Belgrader Kommunalwahlen anzutreten«, erzählt Đorđević über ihre Anfänge in der Politik. Durch den Einzug ins Stadtparlament erhoffte sich die Initiative einen besseren Zugang zu Informationen, um BewohnerInnen schon im Vorfeld über Bauvorhaben wie Waterfront informieren und dagegen mobilisieren zu können. »In einer funktionierenden Demokratie könnten wir für immer AktivistInnen bleiben, weil die Regierung auf Forderungen von Massenprotesten eingehen muss.« In Serbien geschehe das meistens nur vor Wahlen, wie der Fall Rio Tinto im Frühjahr 2022 zeige. Die NdB-AktivistInnen sahen also nur über die Kandidatur bei Wahlen einen Weg zur Veränderung.
2018 scheiterte NdB an der Fünfprozenthürde für den Einzug ins Stadtparlament. Bei den jüngsten Wahlen vom 3. April 2022 erreichte die Initiative mit ihren KoalitionspartnerInnen allerdings knapp elf Prozent. Gleichzeitig mit den Belgrader Kommunalwahlen wurden auch die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abgehalten. »Dass alle Wahlen am gleichen Tag stattfanden, hatte das Ziel, die BelgradWahl zu überschatten«, ist Đorđević überzeugt. In der Hauptstadt hätte die Opposition die größte Chance einen Regierungswechsel herbeizuführen. Um im Wahlkampfchaos nicht unterzugehen, entschied sich MORAMO deswegen bei allen Wahlen anzutreten. Auch wenn wenig Zeit blieb, um eine nationale Liste zusammenzustellen, schaffte MORAMO mit knapp fünf Prozent der Stimmen den Einzug in die serbische Nationalversammlung (Stand:20. Juni 2022). Eine von voraussichtlich 13 MORAMO-Abgeordneten ist Biljana Đorđević. »Obwohl wir hauptsächlich als Grüne wahrgenommen wurden, ist ein wichtiger Teil unseres Programmes linke Politik. Ich will mich für gute Bildung, ArbeitnehmerInnenrechte und Geschlechtergerechtigkeit einsetzen.«
Auch Dorf kann Demo
Die Massenproteste der vergangenen Jahre konzentrierten sich in urbanen Zentren. Zu den Rio-TintoDemos kamen jedoch Menschen aus ganz Serbien, aus verschiedenen Gesellschaftsschichten und mit unterschiedlichsten politischen Einstellungen. Dabei sei es laut Đorđević um einiges schwerer, in kleinen Kommunen Opposition zu zeigen – egal ob aktivistisch oder politisch organisiert. »Die Leute fürchten Anfeindungen oder ihren Job zu verlieren.« Auch stünden weniger Ressourcen zur Verfügung. Und trotzdem finden sich immer wieder Beispiele lokalen Widerstands – sei es der Kleinbauer im südserbischen Rakita, der sich Baggern in den Weg stellte, um »seinen Fluss« vor dem Bau eines Kleinkraftwerks zu beschützen, oder die Großmutter aus Temska, die mit ihren Enkelinnen Gedichte über den Nationalpark Stara Planina vortrug. In den ländlichen Regionen gibt es einige dieser lokalen Initiativen gegen Naturzerstörung. Die BewohnerInnen fühlen sich mit ihrer Umwelt eng verbunden, die Kunst des Fischens im lokalen Fluss wird vom Großvater and den Vater weitergegeben, der es wiederum seinen Kindern beibringt. Ackerflächen werden über Generationen hinweg von derselben Familie bestellt. Laut der serbischen Statistikbehörde arbeiteten 2018 mehr als 1,3 Millionen Menschen in der Landwirtschaft, die meisten in kleinen Familienbetrieben. Gefürchtete Interventionen bedeuten nicht nur den Entzug der Lebensgrundlage, sondern auch das Aus für jahrzehntealte Lebensweisen.
Dies zeigt, Naturschutz mobilisiert die SerbInnen, auch weil entsprechende Maßnahmen bislang fehlen. Tatsächlich widmeten sich die meisten Proteste 2021 diesem Thema. Als Mitglied der grün-linken Koalition ist sich Đorđević daher auch sicher, dass sie bei den Wahlen besser abgeschnitten hätten, »hätten uns die regierungsnahen Medien nicht weitgehend ignoriert.« Auf der Weltrangliste der Pressefreiheit ist Serbien auf Platz 79 von 180 Ländern. Reporter Ohne Grenzen kritisiert vor allem die Einflussnahme der Regierung auf journalistische Berichterstattung und die damit einhergehende Hetze gegen regierungskritische Medien.
Trotz dieser Widrigkeiten kann man ein Umdenken beobachten, nicht nur in Serbien, sondern am ganzen Westbalkan. Lange hieß es, die Bevölkerung habe größere Probleme als Umweltverschmutzung: Arbeitsplatzsicherheit, Nachkriegsspannungen, Rechtsstaatlichkeit und nötige Adaptionen hinsichtlich des EU-Beitritts. Grünparteien verfügten bis vor kurzem über wenig bis keine politische Macht. Doch in Montenegro stellt die Grün-Bewegung United Reform Action (URA) seit April – in einer Minderheitsregierung – den Ministerpräsidenten. Ein grün-linker Bürgermeister regiert seit einem Jahr die kroatische Hauptstadt Zagreb. »Viele unserer Themen beziehen sich auf regionale Probleme«, erklärt Đorđević. Sie pflegt daher auch den Austausch mit ähnlichen Gruppen in den Nachbarländern.
Tatsächlich übersteigt die Luftverschmutzung in Ballungszentren am Balkan jegliche Richtwerte. Die Folgen sind tödlich. Daten des UN-Umweltprogrammes UNEP aus dem Jahr 2019 zufolge sterben jährlich 5000 Menschen aufgrund der schlechten Luft in der Region. Die dadurch dringend notwendige Abkehr von Kohlekraftwerken eröffnet jedoch andere Probleme: Denn die Länder Südosteuropas beheimaten auch die letzten freifließenden Gewässer in Europa. Für die nächsten Jahre sind auf dem Gebiet zwischen Slowenien und Griechenland rund 3000 Wasserkraftwerke geplant. UmweltschützerInnen kritisieren, dass der energetische Nutzen dieser Bauten dem ökologischen Schaden nicht gerecht werde. Sie setzten sich daher zunehmend für den Schutz des sogenannten »Blauen Herzens Europas« ein.

© Ne Da(vi)mo Beograd
Von der Peripherie ins Parlament
Umweltschäden wirken sich direkt auf die Lebensqualität der Menschen aus, weshalb grüne Politik für Đorđević auch automatisch links ist. Aus den Wahlergebnissen will sie für die Zukunft von NdB lernen. Dass sie in Belgrad vergleichsweise gut abschnitten, liege daran, dass sie dort seit Jahren BürgerInnenbeteiligung ermöglichen. »Die Probleme in Belgrad gibt es aber in allen serbischen Städten«, erklärt Đorđević. Der Plan lautet also, ein nationales Netzwerk aus lokalen Initiativen zu formieren, um somit gezielt die Probleme von Kommunen ins Parlament zu tragen. Dafür hat NdB beschlossen, eine Partei zu gründen.
Der Regierungswechsel »ist eine Bedingung, ohne die es unmöglich ist, voranzukommen und Serbien in einen gerechten Staat zu verwandeln«, heißt es in MORAMOs Wahlprogramm. Die Verfehlung dieses Ziels hinterlässt Đorđević dennoch optimistisch: »Die Regierungspartei hat viele Sitze im Parlament verloren und nun können dort wieder Debatten stattfinden.« Bei den Parlamentswahlen 2020 hatte ein Großteil der Opposition die Wahlen wegen unfairer Bedingungen boykottiert. Dadurch führte die Regierungspartei nur Selbstgespräche im Parlament, so Đorđević. Mit einem Lächeln fügt sie hinzu: »Vielleicht gelingt es uns ja beim nächsten Mal.« Bis dahin verfolgt sie weiterhin die Strategie von Protest und Parlamentarismus.
Interview mit Melanie Jaindl und Biljana Đorđević. Biljana Đorđević ist Politikwissenschafterin und unterrichtet an der Universität Belgrad. Sie ist Mitglied des Kleinen Rats der politischen Bewegung Ne Da(vi)mo Beograd und zieht nach den Wahlen 2022 als Abgeordnete in die serbische Nationalversammlung ein.
Ihr Käse ist politisch

Von der Wende gezeichnet und vom Staat enttäuscht: Die BewohnerInnen eines bulgarischen Dorfes setzen lieber auf geschmuggelte Lebensmittel aus Rumänien als auf Supermarktware. Der Schmuggel ist eine Folge neoliberaler Politik, schreibt der Anthropologe STEFAN DORONDEL in seinem Gastbeitrag.
Das Dorf Slanotran liegt in Südwestbulgarien, wenige Kilometer von der Hafenstadt Vidin entfernt. Es gleicht heute einer Geistersiedlung – mit den Ruinen einer Schule, einer verlassenen Arztpraxis aus sozialistischen Zeiten und mehreren geschlossenen kleinen Restaurants. Von den einst 1600 EinwohnerInnen leben heute weniger als 400 in Slanotran. Der Asphalt der Dorfstraßen ist brüchig. Viele Häuser sind verfallen und mit Pflanzen bewachsen, die man nur in den Donauauen finden kann. Einige ihrer BesitzerInnen sind gestorben und haben keine ErbInnen, andere sind für immer weggezogen, um in Westeuropa eine bessere Arbeit zu finden. Letztere kehren meist im Sommer – adrett gekleidet und in schicken Autos – für einen kurzen Besuch ins Dorf zurück. Übrig bleiben die Alten. Sie leben von ihren mageren Renten oder Sozialleistungen. Nutztiere gibt es keine mehr. Die letzten beiden Kühe wurden vor einigen Jahren verkauft. Nur wenige Menschen bewirtschaften die Agrarflächen, manche pflegen einen kleinen Garten hinter dem Haus. Fische dienten vielleicht einmal als Nahrungsquelle, aber die meisten DorfbewohnerInnen sind nun zu alt für diese Arbeit. Die Donau ist nur einen Kilometer vom Dorf entfernt. Dahinter liegt Rumänien.
Geheimer Grenzverkehr
Slanotrans Zustand spiegelt die sozioökonomischen Veränderungen wider, die die politische Wende von 1989 auslöste. Die Kolchosen wurden in der ersten Hälfte der 1990er Jahre zerschlagen und ihre Ländereien und landbezogenen Vermögenswerte privatisiert – ein Prozess, den WissenschaftlerInnen als Entkollektivierung bezeichnen. Das Leben im ländlichen Bulgarien verschlechterte sich infolgedessen kontinuierlich, da sich die Arbeit in der Landwirtschaft nicht mehr lohnte. Stattdessen lockte Westeuropa wie der Gesang einer Sirene mit Arbeitsplätzen und einem besseren Leben. Eine Regierung folgte auf die andere. Sie alle, auch die sozialdemokratischen Regierungen, verfolgten einen neoliberalen Ansatz und trugen nicht zur Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum Bulgariens bei. Vielmehr entstand eine neue, gefräßige Elite in Politik und Wirtschaft. Sie machte die Sache noch schlimmer: Die sogenannten Neureichen werden in vielerlei Hinsicht schlechter als die alten Kader der Kommunistischen Partei wahrgenommen, denn diese waren zumindest gezwungen, ihren Reichtum unauffällig zu halten.
Die BewohnerInnen Slanotrans (und anderer Dörfer) mussten also selbst einen Weg finden, sich durchzuschlagen und ihr Einkommen aufzubessern. Eine Möglichkeit dazu ist der Schmuggel von Lebensmitteln, insbesondere Käse, Tomaten und manchmal auch Zwiebeln. Diese Produkte werden von den Dörfern aus Rumänien, gleich auf der anderen Seite der Donau, eingeführt. Um den grenzüberschreitenden Schmuggel zu verstehen, muss man die unterschiedlichen Bedingungen am bulgarischen und rumänischen Donauufer kennen. Trotz Ähnlichkeiten unterscheiden sie sich nämlich in mindestens zwei Punkten: Erstens ist der reiche Boden der OlteniaEbene – obwohl statistisch gesehen eine der ärmsten Regionen Rumäniens – ein Paradies für die Landwirtschaft. Nach der Entkollektivierung erwiesen sich die kleinen privaten Gewächshäuser, die überall in dieser Region zu finden sind, als effiziente Familienbetriebe. Die Weiden jener Gebiete, die von der sozialistischen Regierung nicht überflutet wurden, eignen sich ideal für die Nutztierhaltung. Zweitens ist die rumänische Seite neben den landwirtschaftlich besseren Bedingungen auch etwas weniger von der Abwanderung betroffen. In Bulgarien erschwert dagegen der Mangel an Arbeitskräften die Tierzucht und den Gemüseanbau.
Der Schmuggel von Käse oder Tomaten wurde durch den Bau der Brücke über die Donau, die Rumänien und Bulgarien etwa zehn Kilometer vom Dorf Slanotran entfernt verbindet, erheblich erleichtert. Schmuggel, also die Einfuhr oder Ausfuhr von Waren ohne Entrichtung der gesetzlichen Zölle, gilt natürlich als illegale Tätigkeit. Doch nicht alles, was illegal ist, ist auch moralisch verwerflich. Ich erkläre, warum. Gemeinsam mit meinem Kollegen und Freund Stelu Şerban hielt ich mich für eine längere Zeit in Slanotran auf, um das ländliche Leben zu studieren. Einer jener Menschen, die uns vor Ort am meisten geholfen haben, ist ein Schmuggler. Nennen wir ihn Georg. Er war zum Zeitpunkt unserer Forschung ein bulgarischer Rentner Anfang fünfzig. Im lokalen Sprachgebrauch ist der Lebensmittelschmuggel keineswegs unmoralisch, solange der aus Rumänien eingeführte Käse weitaus billiger und von besserer Qualität ist als der in den bulgarischen Geschäften erhältliche. Unter den LandbewohnerInnen dieser Gegend kursiert sogar ein Witz, wonach der Supermarkt-Käse zwar nach Käse aussieht, aber einen kleinen Mangel hat: Es fehlt ihm völlig an Milch. So ist er zwar vor Keimen geschützt in Plastik eingewickelt, seine Herkunft ist aber unbekannt. Zudem ist er relativ fade und teurer als jener der rumänischen HirtInnen, die über eine lange Tradition der Käseherstellung verfügen. Das Gleiche gilt auch für Tomaten.
Georg, unser Schmuggler, ist ein Mann der Gemeinschaft, er unterhält gute Beziehungen zu einigen rumänischen SchafhirtInnen. Er kauft Frischkäse von seinen rumänischen FreundInnen, lädt ihn in Plastikfässer, die mit Molke befüllt sind, packt ihn in seinen alten VW-Bus, der definitiv schon bessere Tage gesehen hat, überquert die Brücke mit der Erklärung, dass er nichts zu deklarieren habe, und parkt kurze Zeit später in der Dorfmitte und verkauft den Käse an die DorfbewohnerInnen. Er verkauft das von den Einheimischen als »echten Käse« bezeichnete Produkt auch, indem er die Zahlung annimmt, »sobald die Rente eintrifft«. In den Augen der Einheimischen grenzt dieses Entgegenkommen an Sozialhilfe.
Grenzüberschreitender Widerstand
Eines Tages beschwerte sich der Besitzer eines Dorfladens, der standardisierten Käse verkauft, bei den Behörden über diese Praxis und zeigte Georg wegen Verstößen gegen die Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit an. Doch sobald das Auto der Behörde zu einer unangemeldeten Kontrolle in das Dorf fuhr, wurde Georg von den Leuten vor Ort gewarnt, er solle seine Waren verstecken. Er entkam jedes Mal. Georgs Rolle geht allerdings über jene des »sozialen Schmugglers« hinaus. Als ein Neureicher aus Sofia versuchte, ein Recyclingunternehmen für Altreifen in der Gegend zu eröffnen, waren Georg und andere maßgeblich an einer Protestbewegung beteiligt. Der Investor aus der Hauptstadt wollte hauptsächlich Reifen aus Österreich importieren und vor Ort verarbeiten – mit erheblichen umweltschädlichen Folgen. Den Einheimischen versprach er vermeintlich gute Löhne, die sich allerdings selbst für bulgarische Verhältnisse als niedrige Summen herausstellten. Als sich die Proteste der DorfbewohnerInnen als unwirksam erwiesen, griffen sie zu einer radikalen Geste: Sie besetzten die Donaubrücke und legten den internationalen Verkehr für etwa fünfzehn Minuten komplett lahm. Die Aktion zog so die Aufmerksamkeit nationaler wie internationaler Medien auf sich. Georg hatte dafür sein Netzwerk von FreundInnen und Bekannten sowohl in Rumänien als auch in Bulgarien mobilisiert. Darunter dieselben Personen, die ihm beim Schmuggeln von Lebensmitteln helfen. Mit ihrer Hilfe gelang es ihm, sich unter dem Radar der regionalen Behörden zu bewegen.
Eine der vielen Lehren, die man aus dieser kurzen Geschichte ziehen kann, ist, dass wir neue Worte brauchen, um Aktivitäten zu beschreiben, die aus Sicht des Staates illegal sein mögen, aber von den Einheimischen moralisch geschätzt werden. Eine weitere Lektion ist, dass der neoliberale Staat, der ganze Regionen im Stich gelassen hat, von den Einheimischen als Feind angesehen wird. Jahrelange kriminelle Laissez-faire-Politik ignorierte die Bedürfnisse der Menschen und machte den Staat zu einer Instanz, der man nicht trauen kann und die man nur vermeiden oder anfechten kann.
Autor: Stefan Dorondel ist leitender Wissenschaftler am Institut für Südosteuropastudien Bukarest der Rumänischen Akademie und am Francisc I. Rainer Institut für Anthropologie Bukarest. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen zählt (gemeinsam mit Stelu Şerban) A New Ecological Order. Development and the Transformation of Nature in Eastern Europe (Pittsburgh, PA, US, Pittsburgh University Press).
Städtepartnerschaften im Krieg

Aktiver Austausch oder Name am Papier: Städtepartnerschaften werden sehr unterschiedlich gelebt. Im Fall des Ukraine-Krieges ebneten sie oft den Weg für schnelle humanitäre Hilfe. ROBIN GOSEJOHANN zeigt auf, warum die außenpolitische Wirkung von Städtepartnerschaften nicht unterschätzt werden sollte.
Uns Jugendlichen war nicht klar, was dahinterstand: Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg, Élysée-Vertrag und kommunale Außenpolitik haben für einen Fünfzehnjährigen meistens noch keine Bedeutung. Der Austausch mit dem Gymnasium in der Partnerstadt war eine Gelegenheit, um Gleichaltrige kennenzulernen, die Fremdsprache zu üben und Spaß auf einer langen Klassenfahrt zu haben. Das Spektrum einer Städtepartnerschaft kann also breit sein, aber welches Potential haben solche Formate, wenn in Europa Krieg herrscht?
Es gibt historische Ausreißer: die Städtefreundschaft zwischen Paderborn (Deutschland) und Le Mans (Frankreich) wurde erstmals im Jahr 836 erwähnt, als die »ewige Liebesbruderschaft« zwischen den beiden fränkischen Bischofssitzen geschlossen wurde. Über tausend Jahre später, 1930, gingen Klagenfurt und Wiesbaden eine Städtefreundschaft ein. Die allermeisten Städtepartnerschaften, so wie wir sie heute in Europa kennen, verfolgten allerdings den Wunsch nach Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Städte, vertreten durch ihre BürgermeisterInnen, bauen entweder persönliche Kontakte und Freundschaften aus – oder gingen, wie beispielsweise in Linz, auf die Suche nach Partnergemeinden, die durch ihre Größe, Wirtschaftsstruktur oder geografischen Merkmale Parallelen aufweisen. Der Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) ist der Dachverband der nationalen Verbände der Gemeinden und Regionen aus über 30 europäischen Ländern. Nach seiner Definition versteht man als Städteparnterschaft eine förmliche, zeitlich und sachlich nicht begrenzte Partnerschaft, beruhend auf einem Partnerschaftsvertrag. Die Definition umfasst auch Kreise und Gemeinden, schließt aber populärer werdende Städtefreundschaften oder Projektpartnerschaften ohne formale Festlegung aus.
Aktuell zählt der RGRE rund 26.000 Städtepartnerschaften (Town-Twinning) unter all seinen Mitgliedsverbänden. Für Österreich liegen keine aktuellen Zahlen vor: Eine Erfassung des Wiener KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung umfasst 719 ausländische Partnerschaften und Kooperationen unter insgesamt 487 österreichischen Gemeinden. Das heißt, rund ein Viertel aller Gemeinden arbeitet mit ausländischen Partnergemeinden oder -städten zusammen – auf Basis von formalen oder auch informellen Beschlüssen. Je größer die Gemeinde, desto wahrscheinlicher ist es, dass es eine Städtepartnerschaft gibt. Die meisten dieser Partnerschaften bestehen zu angrenzenden Nachbarländern.
Ukrainische und Russische Partnerstädte
Linz ist eine jener österreichischen Städte, die Partnerschaften mit Stipendien und Auslands aufenthalten fördern und dies auch bewusst kommunizieren. 1994 wurde die oberösterreichische Landeshauptstadt vom Europarat ausgezeichnet, weil ihre zahlreichen Städtepartnerschaften die Idee europäischer Einheit und Brüderlichkeit lebendig machen. Als einzige Stadt Österreichs hat Linz Partnerstädte sowohl in der Ukraine (Saporischschja) als auch in Russland (Nischni Nowgorod). Die ukrainische Stadt liegt nur eine Autostunde von der Kampflinie entfernt und wurde zur Drehscheibe der Hilfe für das nahegelegene Mariupol.
Die Linzer Partnerstadt in Russland verfügt über bedeutende Betriebe der Rüstungsindustrie. Wie wirkt sich der Krieg auf Städtepartnerschaften wie diese aus? Der Kontakt zu Saporischschja sei vor dem Krieg eher sporadisch gewesen, heißt es dazu aus dem zuständigen Magistrat. Es habe an gemeinsamen Projekten gefehlt, meint Andrea Pospischek, die die insgesamt zwanzig Partnerschaften der Stadt überblickt. Bei Kriegsausbruch habe der Linzer Bürgermeister Klaus Luger den Anstoß gegeben, einen Arbeitskontakt ins dortige Rathaus aufzubauen. Das gelang, und mit ukrainischen KollegInnen konnte Pospischek eine Bedarfsliste für einen gezielten Hilfstransport in die Partnerstadt erarbeiten, den Linzer Unternehmen und Privatpersonen zusammenstellten. Das Geld dazu kam aus einer Sammlung der Magistratsbediensteten, die Stadt Linz verdoppelte den Betrag. Und Nischni Nowgorod? Die Partnerschaft mit der russischen Stadt existiere lediglich auf dem Papier – und dabei wolle man es belassen, heißt es aus Linz.
Basis für humanitäre Hilfe
Städtepartnerschaften können also als Grundlage für humanitäre Hilfe dienen. Ein weiteres Beispiel dafür ist die Partnerschaft zwischen der deutschen Stadt Celle in Niedersachsen und der ukrainischen Stadt Sumy. Seit ihrer Begründung im Jahr 1990 schien die Verbindung längst eingeschlafen. Dank des Projekts Urban X-Change Network des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV) International wurde sie im Winter 2021 reaktiviert. Mit Mitteln des Auswärtigen Amtes arbeitet die VHS Celle unter Leitung von Liliane Steinke mit dem LifeLong Learning Center in Sumy, geleitet von Yuriy Petrushenko, zusammen. Gemeinsam mit NGOs fördern sie die Erwachsenenbildung. Der Kriegsausbruch änderte alles, doch die Vision der Zusammenarbeit blieb erhalten. Sumy, nahe an der russischen Grenze, war vom ersten Tag an vom Krieg betroffen. Steinke und Petrushenko reagierten rasch und organisierten Unterkünfte in Celler Privathaushalten für ProjektpartnerInnen und ihre Familien aus Sumy. Zu den 70.000 EinwohnerInnen in Celle kamen seit Februar rund 2000 geflohene UkrainerInnen dazu. Und das gemeinsam erdachte Bildungsprojekt wurde weiterentwickelt, neuer Titel: PEACE-Center der Partnerstädte Celle-Sumy: ART of learning and living together.
Partnerschaft im Ruhemodus
So konkret und pragmatisch Hilfsangebote für ukrainische Partnerstädte sein können, gestalten sich die Beziehungen mit russischen Städten derzeit eher heikel. Einer Recherche der Neuen Zürcher Zeitung zufolge hat von rund 100 offiziellen Partnerschaften zwischen deutschen und russischen Städten jede dritte deutsche Stadt die Verbindung einseitig ruhendgestellt. Dabei sticht die Städtepartnerschaft zwischen dem westfälischen Gütersloh und dem russischen Rschew, westlich von Moskau, heraus: Der Kontakt entstand über VeteranInnen beider Armeen, obwohl um Rschew im Zweiten Weltkrieg außerordentlich schwer gekämpft wurde, auch mit sehr vielen zivilen Opfern. Nach langer Vorbereitung plante Gütersloh, u.a. mit Landesmitteln gefördert, für Mitte Mai 2022 eine Konferenz seiner fünf Partnerstädte aus England, Frankreich, Polen, Russland und Schweden, mit dem Ziel alte Verbindungen zu beleben und frische Impulse des kulturellen Austauschs zu senden. Nach Kriegsausbruch erbat der Gütersloher Bürgermeister Norbert Morkes von seinem russischen Amtskollegen in einem persönlichen, aber offenen Brief eine Distanzierung vom russischen Angriffskrieg. Eine Antwort kam nie. Die Städtepartnerschaft und die Konferenzteilnahme Rschews wurden daraufhin ausgesetzt.
Bevölkerung an Bord bringen
Städtepartnerschaften sind – jede für sich – in beständigem Wandel. Sie bieten Raum für länderübergreifendes bürgerschaftliches Engagement und sind dazu geeignet, die lokale Identität zu stärken und Mehrwerte zu generieren. In der Praxis sind sie stark auf das freiwillige Engagement von BürgerInnen angewiesen, die im Idealfall von den Städten und Gemeinden dabei unterstützt werden. Fehlt dieses ehrenamtliche Engagement oder ein mobilisierendes Projekt, können Städtepartnerschaften in eine Art Ruhemodus verfallen. Eine solche Partnerschaft kann bei konkreten Anlässen allerdings auch reaktiviert werden, und sie bedeutet einen hohen Vertrauensvorschuss. Die Zukunft von Städtepartnerschaften liegt somit weniger in Gemeinderatsbeschlüssen und offiziellen Vereinbarungen, sondern in einem ergebnisorientierten und flexiblen Austausch. Die notwendige Unterstützung der lokalen Bevölkerung erfolgt dann, wenn klar kommunizierte Ziele im Zentrum stehen, bei denen auch der Nutzen für die eigene Stadt ersichtlich wird. Nationale Fördertöpfe für österreichische Städte und Gemeinden finden sich für diese Form der kommunalen Außenpolitik allerdings noch zu wenig.
Autor: Robin Gosejohann
Was macht Grenzregionen fit für die Krise?

Die COVID-19-Pandemie brachte die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa ans Limit – mit negativen Folgen für den Arbeitsmarkt. FIONA FAAS hat sich mit der Widerstandsfähigkeit von Grenzregionen beschäftigt und zeigt am Beispiel der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, was bereits gut läuft und was sich ändern muss.
Als sich Europa im März 2020 zum Brennpunkt der COVID-19-Pandemie entwickelte, schlossen Tschechien und Polen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ihre Grenzen zu Deutschland. Sie ergriffen dabei drastische Maßnahmen der Grenzsicherung: An der Eisenbahnbrücke Hirschfelde auf der Strecke von Zittau nach Görlitz, die über polnisches Gebiet führt, patrouillierten erstmals seit 1990 wieder bewaffnete GrenzsoldatInnen. Wenig später führte auch Deutschland vorübergehende Grenzkontrollen ein. Die Einschränkungen im Grenzverkehr erschütterten den Arbeitsmarkt im Dreiländereck und setzten damit auch die Wirtschaft in der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa in hohem Maße unter Druck. Görlitz und Bautzen zählen seit der Einführung der Freizügigkeit für polnische und tschechische ArbeitnehmerInnen im Jahr 2011 zu den Landkreisen mit den meisten GrenzpendlerInnen in Deutschland. Gerade im Gesundheitssektor arbeiten viele aus dem polnischen und tschechischen Grenzland. Sie waren von den teils undurchsichtigen COVID-Bestimmungen besonders betroffen. Zudem standen sie ungeachtet der tatsächlichen Infektionszahlen vielfach unter Verdacht, das Virus eingeschleppt zu haben.
Belastungsprobe für Zusammenarbeit
Das Corona-Management durchkreuzte dabei das Ziel grenzüberschreitender Kooperation, die durch den Abbau wirtschaftlicher, rechtlicher, politisch-administrativer und kultureller Grenzen floriert. So stellt sich unweigerlich die Frage, wie Grenzregionen mit Krisen wie diesen umgehen und widerstandsfähiger gemacht werden können. Im Zuge einer Masterarbeit an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl widmete ich mich gemeinsam mit Nadine Hügler diesen Fragen. In einer vergleichenden Fallstudie entwickelten wir ein Modell zur Analyse grenzüberschreitend regionaler Widerstandsfähigkeit (Resilienz). Auf Basis bestehender Literatur und mithilfe unseres Modells betrachtete ich die Arbeitsmarktkooperation in der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa im Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien – eine vergleichsweise junge Grenzregion in Mitteleuropa. Die Grenze verlor erst mit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 und dem EU-Beitritt Polens und Tschechiens 2004 ihren trennenden Faktor. Ein integrierter Arbeitsmarkt besteht allerdings auch drei Jahrzehnte später nicht. Es gibt große branchenbezogene Unterschiede im Lohnniveau und Sprachbarrieren zwischen den drei Teilregionen. Die Euroregion scheint auf den ersten Blick ein abgehängter Raum zu sein. Gerade aber mehr Mobilität kann dem anstehenden Strukturwandel und der Überalterung entgegenwirken. Doch durch die Pandemie-Erfahrung sank für viele ArbeitnehmerInnen der Anreiz, in einem der Nachbarländer zu arbeiten. Auch die ArbeitgeberInnen reagieren zögerlich, BewerberInnen aus den Nachbarländern einzustellen oder sich mit dem eigenen Unternehmen dort niederzulassen. Das verdeutlichen Erfahrungsberichte von VertreterInnen arbeitsmarktbezogener Kooperationsnetzwerke, trilateraler Beratungsstellen, interregionaler Gewerkschaftsinitiativen und der Industrie- und Handelskammer. Die Krisenfestigkeit zeigt sich nicht allein durch wirtschaftliche Zahlen. Zudem ist der Zugang zu diesen oftmals erschwert.

© CC BY-NC-ND 2.0 Mac McCreery via Flickr
Allianzen gegen die Krise
Bereits während der ersten Gespräche zeichnete sich eine wichtige Erkenntnis ab: Netzwerke, die handlungsfähig blieben und den Arbeitsmarkt aktiv gestalteten, bildeten die Dreh- und Angelpunkte in der Bewältigung der Krise. Dahinter standen eine entsprechend rechtlich abgesicherte Grundlage, solide Finanzmittel und interkulturell kompetentes Personal. Vor allem mehrsprachige MitarbeiterInnen wirkten positiv auf die Zusammenarbeit. Neben den Kenntnissen der Nachbarsprachen, zeichnete sich der Erfolg auch durch eine gemeinsame Problemwahrnehmung aus. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erlebten sämtliche InterviewpartnerInnen als beeinträchtigend und für einen zeitgemäßen europäischen Arbeitsmarkt rückschrittlich. In manchen Fällen führte dies sogar zu einem gemeinsamen Vorgehen der ArbeitnehmerInnen- und ArbeitgeberInnenseite. Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass Einschränkungen wieder zurückgenommen oder Ausnahmen für GrenzgängerInnen geschaffen wurden. Während solche Allianzen in Nicht-Krisenzeiten oft an entgegengesetzten Interessen scheiterten, erlangten sie im Kontext der Pandemie nun gebündelte Durchsetzungskraft. Das lässt den Schluss zu, dass die Widerstandsfähigkeit von Regionen auch davon abhängt, ob einzelne AkteurInnen oder Netzwerke grenzüberschreitend denken und handeln und im Ernstfall über Eigeninteressen hinwegsehen können.
Wo gibt es weiteren Handlungsbedarf?
Unsere Studie zeigt auch, dass Sprachbarrieren in Grenzregionen weiter abgebaut werden müssen. Damit wird nicht nur die Zusammenarbeit, sondern auch der Arbeitsmarkt insgesamt gestärkt. Krisenmanagement muss immer grenzüberschreitend gedacht werden, denn die behördlichen Rahmenbedingungen haben einen entscheidenden Einfluss darauf, wie lokale AkteurInnen auf Krisen reagieren. Neben der Pandemie machen auch Herausforderungen wie der Klimawandel und die damit verbundenen Extremwetterereignisse keinen Halt vor Grenzen. Im deutsch-polnisch-tschechischen Dreiländereck wurde deutlich, wie lokale und private Initiativen Aufgaben übernehmen, wenn das zwischenstaatliche Krisenmanagement scheitert. Dazu zählen nicht nur die von uns betrachteten Kooperationsnetzwerke, sondern auch die Zivilgesellschaft und nicht zuletzt einzelne sehr engagierte BürgerInnen. Ihre Rolle bei der Krisenbewältigung genauer in den Blick zu nehmen, wäre daher eine lohnende Aufgabe für die weitere Forschung über die Resilienz von Grenzregionen.
Autorin: Fiona Faas hat European Studies an der Universität Passau studiert und ihren Master an der Verwaltungshochschule Kehl absolviert, wo sie die geschlossenen Grenzen in der deutsch-französischen Grenzregion hautnah miterlebte. Aktuell ist sie Trainee am IDM in Wien.
Herkulesaufgabe für die Demokratie

Wird die repräsentative Demokratie als beste Regierungsform abgelöst? Über Machtkämpfe, Vertrauensverlust und den Trend zu lokalen Antworten auf globale Probleme schreibt DANIEL MARTÍNEK in seinem Kommentar.
Die repräsentativen Demokratien Europas befinden sich in der Krise. Das zeigt sich etwa in der schwindenden Bedeutung politischer Großparteien, in niedriger Wahlbeteiligung oder in einem allgemeinen Misstrauen gegenüber PolitikerInnen und Institutionen. Die überholte und teils autoritäre Politik einiger Regierungsparteien in den Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas trägt zu diesem Trend bei. Sie ist aber auch Grund, warum sich lokale Initiativen, Bewegungen und Bündnisse als Gegenmacht zu den nationalen Regierungen formieren.
Der Charakter dieses lokalen Aufbruchs unterscheidet sich je nach den Umständen, in denen er sich entwickelt und reicht weit über die Städte hinaus bis in abgelegene ländliche Gebiete. Die Spannbreite ist groß und umfasst neben BürgerInneninitiativen, ökologischen Gruppen oder Parteien, die aus Protestbewegungen hervorgehen, auch BürgermeisterInnen-Allianzen und kommunal verwaltete Plattformen. Sie alle entstehen, um die lokale Mitbestimmung zu stärken und bei jenen Fragen mitreden zu können, auf die die Regierung ihrer Meinung nach unzureichende oder gar keine Antworten liefert. Basisdemokratische Kräfte wie diese verleihen der uralten Idee der Demokratie von unten neuen Auftrieb.
Politisches Establishment herausfordern
Es existiert keine Übersicht aller bestehenden gemeinschaftsbasierten Initiativen in der Region Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Eine solche zu schaffen wäre auch schwierig, da sich diese Initiativen in Umfang, Inhalt, Grad der Partizipation und Bedeutung unterscheiden. Strukturell können wir zwischen zwei Formen von lokalen Veränderungskräften unterscheiden: eine institutionalisierte und eine informelle. In der ersten kommen Städte, Gemeinden und kommunale Einrichtungen zu Bündnissen zusammen oder schaffen transnationale Plattformen. Dazu zählen etwa Netzwerke wie Fearless Cities, URBACT, Eurotowns oder Pact of Free Cities, die sich über nationalstaatliche Grenzen hinaus austauschen und miteinander kooperieren.
Zur zweiten Form gehören von der Zivilgesellschaft initiierte, eher spontan und anlassbezogene Bottom-up-Projekte wie BürgerInneninitiativen, die den lokalen Status quo herausfordern und Veränderungen bewirken. Zumeist stehen sie dadurch im Widerspruch zum herrschenden politischen Establishment. Werden Mitglieder lokaler Initiativen in die Stadt- und Gemeinderäte gewählt, vertreten sie dort die Interessen der Protestierenden. So werden zivilgesellschaftliche Kräfte institutionalisiert oder durchdringen bestehende Strukturen, was auch zu Konflikten führen kann. PolitikerInnen, die ihre Anfänge in Bewegungen wie Miasto jest Nasze in Warschau, Zagreb je NAŠ! in der kroatischen Hauptstadt oder Ne da(vi)mo Beograd in Belgrad machten, sind nur einige Beispiele für aktivistisches Engagement, das auch parteipolitische Wege einschlägt. Angesichts der überall wachsenden politischen, ökologischen und sozialen Probleme geht dieses Phänomen auch über Hauptstädte und urbane Räume hinaus. Gerade Umweltbewegungen mobilisieren die lokale Landbevölkerung gegen Naturzerstörungen.
Chancen und Barrieren des lokalen Aufbruchs
Solche Aktivitäten öffnen den Blick für ein neues Verständnis von Machtverteilung und Demokratie, die von einer repräsentativen in eine partizipative Herrschaftsform umgewandelt wird. Viele der genannten Initiativen teilen gemeinsame Ziele. Sie alle befassen sich mit brennenden Themen unserer Zeit und ihren Auswirkungen auf das lokale (teils auch globale) Umfeld: die Klimakrise, ausreichender und angemessener Wohnraum, soziale Ungleichheit, verantwortungsvolle Regierungsführung. Dabei fordern sie die Einhaltung von Menschenrechten, individuelle Freiheiten, Transparenz, Inklusion und Rechtsstaatlichkeit ein. Oft streben sie eine soziale, grüne und diverse Lokalpolitik an.
Mit Forderungen wie diesen und dem Ziel, dem politischen Klientelismus und Tribalismus etwas entgegenzustellen, stoßen lokale Initiativen auf den Widerstand bestehender Strukturen und Hierarchien. Ihr Anspruch, bei Entscheidungen gehört zu werden, fordert zentralistische Nationalstaaten heraus. Daher werden solche Projekte in der Regel nicht von den Regierungen unterstützt, ganz im Gegenteil, sie versuchen, diese Aktivitäten zu unterbinden.
Zukunft der Demokratie
Trotz allen politischen Drucks demonstrieren lokale Bewegungen ihre Vitalität, indem sie mit sehr begrenzten Ressourcen und unter ungünstigen Umständen für ihre Ziele eintreten. Gleichzeitig rütteln sie an bestehenden Machtverhältnissen. Eine der größten Herausforderungen besteht jedoch weiterhin darin, die Bevölkerung zu überzeugen und zu motivieren, diese neue Art der Machtverteilung zu unterstützen. Dieser Machttransfer bildet jedoch eine Herkulesaufgabe für die Länder Mittel-, Ost- und Südosteuropas, wo die Zivilgesellschaften schwach ausgeprägt und politisch gespalten sind.
Politik zu den Menschen zu bringen ist daher eine wichtige Aufgabe für lokale Initiativen. Sie müssen die Bevölkerung überzeugen, dass lokales Engagement bedeutet, ihre eigene Zukunft zu gestalten. So kann die Krise der repräsentativen Demokratie langfristig zu partizipativen Entscheidungsprozessen führen und lokale Beteiligungsprojekte fördern. Dafür ist eine engere Zusammenarbeit und ein Austausch zwischen Bottom-up-Projekten und lokalen Institutionen und Behörden notwendig. Zugleich müssen sie Allianzen über die Grenzen des Lokalen hinaus bilden, um Antworten auf globale Probleme zu finden.
Autor: Daniel Martinek
Regional Perspectives on the war in Ukraine / Conference
International conference organised by the Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM), the Institute of European Integration and Regional Studies at the Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University and the Center for the Study of Conflict & Peace at the University of Osnabrück.
Questions after the unjustified attack of the Russian Federation against Ukraine developed from “how could we let this happen” through “what can we do to help” to “when will it end”? As the war is ongoing for almost four months, three institutions from Chernivtsi, Osnabrück and Vienna brought together experts to discuss the war in Ukraine as well as its implications for the wider Danube Region.
PROGRAMME
Welcome by the organisers
First Panel: Assessing the dynamics of the war: Military, political & humanitarian situation in Ukraine
- Anatoliy Kruglashov (Yuriy Fedkovych National University of Chernivtsi)
- Nadija Afanasieva (UIIP Kyiv)
- Nataliya Vinnykova (V.N. Karazin Kharkiv National University)
Moderator: Sebastian Schäffer (IDM)
Followed by open discussion among other invited experts & audience
Coffee break
Second Panel: Assessing consequences & prospects: The war and the wider Danube Region
- Minna Ålander (SWP Berlin)
- Andreas Umland (Stockholm Centre for Eastern European Studies at the Swedish Institute of International Affairs/Kyiv)
- Mihai-Razvan Ungureanu (IDM/Romanian Centre for Russian Studies at University of Bucharest)
Moderator: Ulrich Schneckener (University of Osnabrück)
Followed by open discussion among other invited experts & audience
Final Concluding remarks by the organizers
End of conference
Welcome to the new website of the Institute for the Danube Region and Central Europe
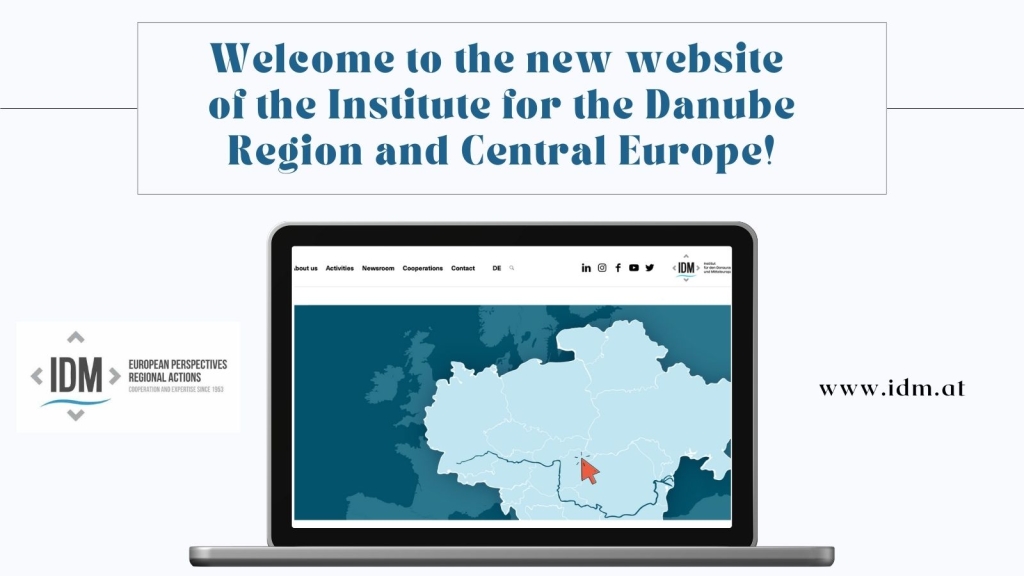
If you want to move forward, you have to stay mobile. Therefore, the IDM is now getting a new home in virtual space. On 1 July 2022, our new website www.idm.at went online. We are still working at full speed to improve it. For technical reasons, however, all old links will no longer work. We would therefore like to thank you for your understanding that there may be a few inconveniences during this transition period!
Visit us at the new digital home of the IDM!
Our current events, publications, podcasts and expertise are already available to you in the new design. We hope you will quickly get used to the new structure and are pleased with the improvements: Above all, the relaunch gives us more freedom and flexibility to provide attractive information about the target countries of our institute. A separate blog offers new opportunities to optimally communicate analyses and comments on important developments. Another highlight is the interactive map on the home page, behind which we continuously collect the latest expertise on the target countries. Current information on Ukraine can be found here. Discover the new online reader for our publications! From now on you can conveniently browse through the latest policy paper from our experts on our website or download the latest issue of Info Europa for later. We also make it easier for you to get involved in the region. In the future, IDM membership will only be a few clicks away.
Having trouble finding something on the new website? Do you encounter other barriers? Please let us know – our administrators are happy to receive tips on how to improve it! (idm@idm.at)
We wish you an informative start to the summer – with the new IDM website!
Your IDM team